DIE ZEIT, 06.07.2006
Tricksen erlaubt
Auf immer neuen Schleichwegen umgehen internationale Unternehmen die deutsche Steuer. Ganz legal. Kann die geplante Reform dem ein Ende setzen? Von Marc Brost und Arne Storn
Immer einen Zug voraus – und der Fiskus kann nicht gewinnen.
Es ist wenig bekannt über dieses Treffen Ende Mai in Berlin, aber das wenige genügt, um die Sorgen des klammen Finanzministers zu vergrößern. Mehr als 200 Spitzenmanager internationaler Konzerne, die sich einen Tag lang erklären ließen, wie ihre Unternehmen ganz legal weniger Steuern zahlen? Eine von Wirtschaftsprüfern organisierte Konferenz, bei der es vor allem darum ging, welche Lücken die nationalen Gesetze bieten?
Tausende Experten arbeiten täglich an immer neuen Modellen, mit denen internationale Konzerne immer weniger Steuern zahlen müssen. Sie veranstalten große Konferenzen, sie verkaufen den Firmen ihre Strategien, sie helfen den Unternehmen, einen Schritt schneller zu sein als der Finanzminister. Im Grunde ist das nicht anders als bei einem Privathaushalt: Jeder normale Angestellte schöpft bei der Steuererklärung legale Möglichkeiten aus, um weniger zahlen zu müssen. Je mehr Sonderregeln das Gesetz bietet, desto größer die Chancen. Der entscheidende Unterschied: Bei jedem Konzern geht es um viele Millionen – und die Beratung ist professioneller. Denn nirgendwo lohnt sich das Geschäft der Steuervermeidungsindustrie so sehr wie in Deutschland: Hier sind die Steuersätze so hoch wie in kaum einem anderen Land. Und es gibt riesige Spielräume, um die Abgaben legal zu senken.
Früher produzierte ein Unternehmen in Deutschland und zahlte hier auch seine Steuern. Heute wird weltweit investiert, geforscht und produziert – und noch der kleinste Unterschied zwischen den nationalen Steuerregeln zum eigenen Vorteil genutzt. Staaten senken ihre Steuersätze, um Investoren anzulocken. Das fordert andere Staaten heraus – die ihre Steuern dann noch weiter senken. Es ist ein Wettlauf, dessen Ende niemand absehen kann. Längst sind es nicht mehr nur Steueroasen wie die Cayman Islands, die Deutschland unter Druck setzen, sondern europäische Wettbewerber wie Irland oder die Slowakei.
Mit seinem heutigen Steuersystem macht es Deutschland den einheimischen Unternehmen besonders leicht, zu gehen – und ausländischen Konzernen schwer, zu kommen. Um das zu ändern, will die Große Koalition die Unternehmensteuern reformieren und Schlupflöcher schließen. Doch mit ihren Plänen kann sie den Kampf gegen die Steuervermeidungsindustrie nicht gewinnen.
Wie das Spiel mit den Steuern funktioniert, erklären die Berater an der Schautafel. Ein schmuckloses Büro, irgendwo in einer deutschen Großstadt. Die beiden Männer malen Firmenstrukturen auf, sie sprechen von »LuxCos« und »AkquiCos«, von Gesellschaften, die man für 27.000 Euro im Internet kaufen und sofort nutzen kann.
Ihre Kunden sind die Finanzvorstände großer Konzerne, die Chefs der Steuerabteilungen und Finanzinvestoren, die deutsche Firmen kaufen wollen.
Diskretion ist in der Steuervermeidungsindustrie alles, zu verschenken gibt es nichts. »Fehler werden nicht verziehen«, sagt einer der beiden. Es sind vor allem die vier großen Prüfungsgesellschaften, die dieses Geschäft beherrschen: KPMG, Deloitte, Ernst & Young und PricewaterhouseCoopers. Dazu kommen internationale Anwaltskanzleien wie Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters oder Shearman & Sterling. Es ist eine Industrie, die Milliarden bewegt. Knapp 88 Milliarden Euro haben Unternehmen im vergangenen Jahr an den deutschen Fiskus gezahlt – nachdem einige von ihnen ganz legal ihre Steuern herunterschraubten. Ein Indiz dafür: Noch Ende der neunziger Jahre waren die gezahlten Dividenden der deutschen Kapitalgesellschaften doppelt so hoch wie die gezahlten Steuern. Inzwischen sind sie viermal so hoch. Die Gewinnausschüttungen der Konzerne steigen stärker als ihre Steuerzahlungen.
Vor allem Hedge-Fonds und Private-Equity-Investoren haben dieses Spiel noch einmal richtig in Schwung gebracht. »In den vergangenen zwei Jahren haben wir 70 Prozent unserer Zeit mit der Beratung von Finanzinvestoren verbracht«, sagt einer der Steuerexperten. »Die gehen im Rahmen des Legitimen an den Anschlag«, ergänzt sein Kollege. Die Finanzinvestoren schielten noch stärker auf die Rendite und die Höhe der Steuerzahlungen als die klassischen Konzerne; sie drängten auf Tempo und Effizienz. »Der Chef der Steuerabteilung eines Konzerns erwartet auf seine Frage eine seitenlange Antwort, ein Finanzinvestor eine siebenzeilige E-Mail.«
Gleichzeitig avanciert die Steuergestaltung bei nahezu allen Unternehmen zu einem zentralen Element der Geschäftsstrategie. Eine wichtige Maßzahl ist die Steuerquote – also das Verhältnis der gezahlten Steuern zum Konzerngewinn vor Steuern. Diese Effective Tax Rategilt unter Analysten inzwischen als wichtige Kennziffer bei Firmenvergleichen. Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers steigt der Börsenwert eines Unternehmens deutlich, wenn die Steuerquote sinkt. In Einzelfällen orientiert sich daran sogar die Vergütung des Finanzvorstands. os.zeit.de/bild
»Wer die Konzernsteuerquote um ein Prozent senkt, kann sein Konzernergebnis spürbar verbessern«, sagt Dieter Endres, Vorstand bei PricewaterhouseCoopers. »Bei Veranstaltungen zeige ich den Unternehmen gerne Grafiken, wie viele Autos oder Waschmaschinen sie zusätzlich verkaufen müssten, um den gleichen Effekt zu erzielen.«
Die Möglichkeiten der Steuervermeider sind vielfältig (siehe Grafik auf der nächsten Seite):
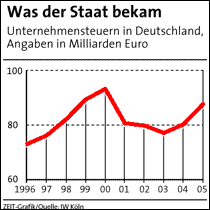
Ein Unternehmen kann eine Finanzierungsgesellschaft in einem Land mit niedrigen Steuersätzen gründen, etwa in Irland. Ihr werden alle Immobilien, Lizenzen oder Patente überschrieben. Für deren Nutzung muss der Betrieb in Deutschland fortan zahlen, das drückt hierzulande den Gewinn und die Steuern. Die Einnahmen der Finanzierungsgesellschaft wiederum werden in Irland niedriger besteuert als in Deutschland.
Ein Konzern, der an mehreren Standorten in der Welt produziert, kann innerhalb des gesetzlichen Rahmens seine internen Preise so festsetzen, dass er Gewinne ins Niedrigsteuerland verschiebt. Und der Rahmen lässt durchaus Raum fürs Verschieben.
Finanzinvestoren beladen die von ihnen gekauften Firmen mit Schulden – die fälligen Zinszahlungen drücken dann die Steuerlast.
Es gibt zahlreiche solcher Kniffe, und alle funktionieren, weil die einzelnen Staaten kaum zusammenarbeiten. So genannte Doppelbesteuerungsabkommen verhindern nur, dass ein Unternehmen seine Einnahmen in zwei Ländern versteuern muss. Darüber hinaus bleiben riesige Lücken, gerade in Deutschland.
Ganz legal subventioniert der hiesige Fiskus den Export von Arbeitsplätzen in Länder, die weniger Steuern verlangen. Ein deutscher Konzern etwa, der eine Tochtergesellschaft in einem Niedrigsteuerland gründet, kann die Ausgaben dafür in Deutschland absetzen – während fast alle Einnahmen dieser Tochtergesellschaft am deutschen Fiskus vorbeifließen. So etwas gibt es in kaum einem anderen Industrieland. »Jeder Staat hat unterschiedliche Regeln, daraus ergeben sich die Spielräume, die ein guter Steuerplaner ausnutzt«, sagt Thomas Rixen, der an der International University Bremen den weltweiten Steuerwettbewerb erforscht. Heute muss sich der Fiskus seine Milliarden mühsam zusammenklauben: Allein im vergangenen Jahr zahlten deutsche Unternehmen rund 13,5 Milliarden Euro nach – weil Betriebsprüfer die Berechnungen der Firmen moniert hatten.
Dazu kommt: Die amtlichen Zahlen des Finanzministers hinken der Realität hinterher. Welches Unternehmen wie viel Steuern wann und wo gezahlt hat, weiß zwar das Finanzamt vor Ort – aufbereitet und weitergeleitet werden diese Zahlen aber nicht. Es gibt keine Branchendaten und keine Informationen, die zwischen Kapital- und Personengesellschaften unterscheiden. Die Europäische Kommission hat in der Frage schon vor den Deutschen kapituliert, die nicht einmal verlässliche Schätzungen liefern können: In der Brüsseler Tabelle über die Unternehmensbesteuerung in Europa fehlen die deutschen Zahlen (ZEIT Nr. 25/06). »Da lacht sich das Ausland doch kaputt«, sagt Stefan Bach, Steuerexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.
Wenn einige Unternehmen ganz legal ihre Steuern drücken, entsteht ein doppeltes Problem. Erstens entgeht dem Staat Geld, das womöglich schon eingeplant war. Ein Beispiel: Nach der Übernahme des Armaturenherstellers Grohe durch Finanzinvestoren 2004 musste die Stadt Lahr, einer der Standorte Grohes, kräftig Gewerbesteuer zurückzahlen. Dem Bürgermeister fehlen jetzt fünf Millionen Euro in der Kasse, um Schulen und Straßen zu sanieren.
Zweitens benachteiligt es all jene Betriebe, die keine Chance haben, ihre Steuern zu minimieren – zum Beispiel, weil sie nur im Inland tätig sind. Sie zahlen die regulären hohen Sätze. Ein klarer Wettbewerbsnachteil. »Das ist das heimliche Gerechtigkeitsproblem«, sagt Steuerforscher Rixen. Um wenigstens auf dieselben Nachsteuererträge wie ihre Konkurrenten zu kommen, müssen diese Firmen alles unternehmen, um ihre Rendite zu steigern. Im Klartext: Der Druck auf die Jobs steigt. Am Ende bezahlen die Angestellten des einen Betriebs die ganz legalen Steuersparmodelle des anderen.
Entzieht die Wirtschaft dem Staat also die Finanzierungsgrundlage? »Wir bewegen uns in dem Rahmen, den das Gesetz vorgibt«, wehrt sich der Deutschland-Chef eines großen Finanzinvestors. Auch die beiden Steuerstrategen mögen an ihrer Arbeit nichts Verwerfliches erkennen. »Ich stehe hinter dem, was ich tue«, sagt einer von ihnen. Meist gehe es darum, bei einer ohnehin geplanten Übernahme oder dem Bau einer neuen Fabrik im Ausland keine unnötigen Steuern zu zahlen. »Für Konstruktionen, die vorrangig der Steuervermeidung dienen, habe ich nur eingeschränkt Verständnis.«
Es passt zu den Konstruktionsfehlern des deutschen Steuersystems, dass offensichtlich nur ein Wirtschaftsingenieur in der Lage ist, die gravierendsten Mängel zu benennen. Lorenz Jarass, 55 Jahre, Professor an der Fachhochschule Wiesbaden. Ein Kämpfer gegen das Establishment – gegen die im Sachverständigenrat oder in der Stiftung Marktwirtschaft arbeitenden Wissenschaftler, die seit Jahren die herrschende Meinung formen: Die deutschen Steuersätze seien zu hoch, deshalb seien die Unternehmen nicht wettbewerbsfähig.
Jarass war der Erste, der nachrechnete – und auf eine viel niedrigere tatsächlich bezahlte Steuerlast kam. Seitdem tobt die Debatte, ob Deutschlands Konzerne bei einer Steuerreform entlastet werden müssen oder nicht.
Nun ist der Professor kein linker Ideologe, »ich könnte auch mit viel niedrigeren Steuersätzen für Unternehmen leben«, sagt er. Er will nur, dass alle Firmen jene Summen zahlen, die sie auf dem Papier auch zahlen müssen. »Ich kämpfe nicht gegen die Steuervermeidungsindustrie, sondern gegen die Irrationalität des Steuersystems«, sagt Jarass. Das tut er in Büchern und Aufsätzen. Und es ist wohl nicht ganz zufällig, dass sich einige seiner Ideen in der aktuellen Debatte wiederfinden. »Wenn man wirklich Schlupflöcher schließen will, dann muss man die Steuersystematik an die Realität anpassen«, sagt er. »Dann muss man auch Zinsen und Lizenzgebühren beim zahlenden Betrieb besteuern, damit internationale Konzerne sich nicht mehr künstlich arm rechnen können.«
Tatsächlich hat Peer Steinbrück genau das vor. Am 12. Juli will der Finanzminister im Bundeskabinett die Eckpunkte der Unternehmensteuerreform verabschieden lassen. Bis zum Herbst sollen die Details festgeklopft sein (siehe nebenstehenden Text):
Niedrigere Steuersätze sollen jene Betriebe entlasten, die keine Chance haben, ihre Steuern zu minimieren, und die heute den regulären hohen deutschen Satz zahlen.
Die vom Unternehmen gezahlten Zinsen, Mieten oder Lizenzgebühren sollen künftig versteuert werden. Damit würde der Anreiz weitgehend wegfallen, Gewinne konzernintern ins Ausland zu verlagern.
Noch freilich tobt vor allem innerhalb der Union der Kampf, ob man Schuldzinsen wirklich besteuern darf. Hessens Ministerpräsident Roland Koch ist dafür, die große Mehrheit in der CDU ist dagegen. Auch die Industrie wehrt sich. »Keinesfalls«, heißt es in einem Schreiben von BDI-Präsident Jürgen Thumann an diverse CDU-Politiker, dürfe die Lage der Unternehmen »durch die Besteuerung von Kosten (Zinsen, Mieten, Pachten, Leasing etc.) verschärft werden«. Steinbrück wiederum hat zuletzt erkennen lassen, dass er darauf nicht beharrt. In diesem Fall aber müsse die Union Alternativen nennen, mit denen sich »die Nettoverluste für den Fiskus in Grenzen halten«.
Doch solange sich die Steuersätze international deutlich unterscheiden, werden die Steuervermeider Schlupflöcher auftun. »Sollten Unternehmen ihre Zinszahlungen künftig nur noch bedingt absetzen können, werden Leute neue Wege finden – und das ganz legal«, sagt einer der beiden Steuerexperten. Sein Kollege erwartet von Steinbrücks Reform höchstens »kurzfristig« höhere Staatseinnahmen.
Auch wenn der Finanzminister jetzt die Sätze senkt – er senkt sie in der Logik des Steuerwettbewerbs immer noch nicht stark genug. Darüber hinaus machen seine Pläne das Recht an einigen Stellen wieder komplizierter. Deutschland könnte im Kampf gegen die Steuervermeidungsindustrie tatsächlich erfolgreich sein. Das aber geht nur mit noch niedrigeren Sätzen, die das Land im globalen Steuerwettbewerb attraktiver machen – und zugleich den Anreiz für die Unternehmen senken, Steuern um jeden Preis zu vermeiden. Und mit einem stark vereinfachten Steuerrecht, in dem es nur noch wenige Ausnahmen gibt, die Großunternehmen zum eigenen Vorteil nutzen können.
Niemand weiß das besser als die Berater selbst. Umso mehr wundern sie sich über die kleine Reform der Großen Koalition. »Die Regierung kuriert nur an den Symptomen, beseitigt aber nicht die Ursachen«, sagt einer der beiden. Er wird auch künftig genug Arbeit haben.
Wie Aktionäre gewinnen und der Fiskus verliert
Wie der Verkauf deutscher Unternehmen das Steueraufkommen senken kann
© DIE ZEIT, 06.07.2006